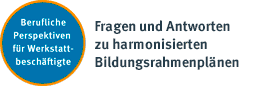Wenn das Wörtchen ‚wenn’ nicht wär’, bräucht’ es keine Werkstatt mehr. Ein modifizierter Kinderreim, ein bisschen ironisiert und trotzdem zutreffend. Denn: Wenn sich die Erwerbswirtschaft den Menschen mit bestimmten und schweren Behinderungen nicht verschließen würde, wären viele Werkstätten für behinderte Menschen nicht mehr erforderlich. Dann wären übrigens auch besondere Integrationsbetriebe nicht mehr nötig und die Arbeitslosigkeit unter den schwerbehinderten Arbeitssuchenden wäre wesentlich geringer.
Nicht einmal die „Stille Reserve“ des Arbeitsmarktes
Warum gibt in der Bundesrepublik Deutschland über 630 Werkstätten mit über 1.400 Zweig- und Nebeneinrichtungen, wenn sie oder soviel von ihnen eigentlich gar nicht nötig wären?
Warum gehen an den Arbeitstagen fast 250.000 Erwachsenen in die Werkstatt in ihrer Nähe und nicht zu ihrem Arbeitsplatz in der Schreinerei am Wohnort, im nahen Lebensmittel-Discounter, im benachbarten Industriebetrieb, in einer Bank oder Behörde?
Die Antwort ist so einfach und lässt sich doch nur mit großen Hemmungen formulieren: Weil diese Menschen in der gewinnorientierten Erwerbswirtschaft und in einer auf effiziente Leistungen ausgerichteten Verwaltung keinen Platz haben. Sie werden nicht gebraucht. Vom arbeitsmarktpolitischen Standpunkt aus gesehen werden sie nicht einmal zur sogenannten Stillen Reserve gezählt.
Warum werden sie nicht gebraucht? Weil sie dem allgemeinen Produktivitätsmaßstab und den Leistungs- und Verhaltensansprüchen eines gewinnorientierten Arbeitsablaufes nicht standhalten können. Dafür arbeiten sie zu langsam, sind nicht konzentriert und nicht ausdauernd genug, ihre Leistungen sind zu unregelmäßig, sie benötigen Ansprache, Fürsprache und Stimulans. Sie leisten insgesamt zu wenig im Vergleich zum statistischen Durchschnitt.
Der Personenkreis in den Werkstätten ist lebenslang auf Beistand und Nachteilsausgleich angewiesen, verursacht deshalb Kosten und hat auf dem privatwirtschaftlich dominierten Arbeitsmarkt keinen Verkaufswert. Das klingt obszön und ist es auch. Denn man bemisst den Menschen nach seiner Arbeitskraft. Sein Schicksal hängt ab von seiner Leistungsfähigkeit, seiner Flexibilität, Mobilität, Qualität – von seiner Verwertbarkeit. Die Wahrheit ist so scheußlich wie sie sich liest: Wessen Arbeitskraft den allgemeinen Maßstäben nicht standhält, hat für die Erwerbswirtschaft keinen Marktwert. Der muss sogar noch Geld mitbringen, wenn er überhaupt eine Chance im Erwerbsleben haben will. Dieses Schicksal teilen inzwischen auch andere Bevölkerungsgruppen mit den Werkstattbeschäftigten. Allerdings können die letzteren noch so viel Geld mitbringen – die Erwerbswirtschaft und alle nach ihren Grundsätzen organisierten Behörden, Institutionen und Verwaltungen würden sie nicht einstellen.
Die Humanität, zu der wir Deutschen uns nach 1949 mit unserem neugeschaffenen Sozialstaat diesen Menschen gegenüber durchringen konnten, manifestierte sich erst in den 1970er Jahren in den Werkstätten. Sie sind mit historischen Maßstäben gemessen noch ganz jung. Und sie stehen auf tönernen Füßen, die leicht von heftigen Wirtschaftskrisen zerstört werden könnten. In dieser Situation befinden wir uns derzeit: Es besteht die Gefahr eines allmählichen Abbaus staatlicher Leistungen für diese Bevölkerungsteile und damit einer Aushöhlung der Aufgaben und fachlichen Anforderungen der Werkstätten.
Riesenschritte
Es ist ohne geschichtliches Beispiel, dass sich der Deutsche Bundestag 1974 mit den Werkstätten als völlig neuem Einrichtungstypus befasste und „Grundsätze zur Konzeption der Werkstatt für Behinderte“ verabschiedete.[1]
 Erstmals hatte damit ein deutscher Souverän eindeutig Stellung für einen Bevölkerungsteil bezogen, der bis dahin wegen seiner oft lebenslangen Erwerbsunfähigkeit nicht als gleichwertig und über Jahrhunderte nicht als förderungswürdig oder förderungsfähig galt.[2]
Erstmals hatte damit ein deutscher Souverän eindeutig Stellung für einen Bevölkerungsteil bezogen, der bis dahin wegen seiner oft lebenslangen Erwerbsunfähigkeit nicht als gleichwertig und über Jahrhunderte nicht als förderungswürdig oder förderungsfähig galt.[2]  Nur ein Jahr später überwand 1975 der Deutsche Bundestag eine bis dahin für unüberwindbar gehaltene sozialpolitische Barriere und öffnete den Werkstattbeschäftigten einen Zugang in die gesetzliche Sozialversicherung. Seit dem sind Werkstattbeschäftigte kranken- und rentenversicherungspflichtig, ohne dass sie Arbeitnehmer sind und unabhängig von der Höhe ihres selbst erwirtschafteten Einkommens.
Nur ein Jahr später überwand 1975 der Deutsche Bundestag eine bis dahin für unüberwindbar gehaltene sozialpolitische Barriere und öffnete den Werkstattbeschäftigten einen Zugang in die gesetzliche Sozialversicherung. Seit dem sind Werkstattbeschäftigte kranken- und rentenversicherungspflichtig, ohne dass sie Arbeitnehmer sind und unabhängig von der Höhe ihres selbst erwirtschafteten Einkommens.Vom sozialpolitischen und rechtlichen Standpunkt aus hat sich der deutsche Sozialstaat in den 70er Jahren weithin von seinen bis dahin geltenden diskriminierenden Rechtsnormen getrennt und die Werkstattbeschäftigten in ihren Schutzrechten weitgehend den Arbeitnehmern gleichgestellt. Der sozialstaatliche Erfolg konnte auch nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten gesichert werden:
- Werkstattbeschäftigte haben Anspruch auf einen angemessenen und arbeitslebenslang gesicherten Arbeits- oder Beschäftigungsplatz,
- sie haben Anspruch auf qualifizierte und individuelle Leistungen durch die Werkstatt,
- sie haben Anspruch auf einen Werkstattvertrag, in dem diese Leistungen analog zum geltenden Recht präzisiert werden müssen,
- sie haben Anspruch auf arbeits- und arbeitsschutzrechtliche Gleichstellung gegenüber dem erwerbstätigen Teil unserer Bevölkerung,
- sie sind - trotz voller Erwerbsminderung - in der Kranken- und Rentenversicherung der erwerbstätigen Bevölkerung gleichgestellt,
- sie haben mit allen finanziellen Transferleistungen ein gesichertes Grundeinkommen,
- sie haben Anspruch auf Mitwirkung im Werkstattgeschehen durch gewählte Räte und zwar unabhängig von den immer noch geltenden unwürdigen Bestimmungen im Bürgerlichen Gesetzbuch über die Geschäftsfähigkeit.[3]

1977 konstatierte Bundesarbeitsminister Herbert Ehrenberg: Wir „verfügen heute in der Bundesrepublik über ein schon weithin geschlossenes Netz von 230 Werkstätten für Behinderte mit rund 30000 Arbeitsplätzen. Das bedeutet, dass für einen großen Teil der Schwerbehinderten, für die der allgemeine Arbeitsmarkt wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung verschlossen ist, die Voraussetzungen für eine berufliche Förderung und eine dauerhafte Eingliederung in das Arbeitsleben geschaffen worden ist“.[4]
 Der Minister hat sich sehr verrechnet und die Integrationskraft der privaten Erwerbswirtschaft weit überschätzt.
Der Minister hat sich sehr verrechnet und die Integrationskraft der privaten Erwerbswirtschaft weit überschätzt. Um bundesweit einigermaßen einheitliche und vergleichbare Bedingungen für diese Einrichtungen zu schaffen, die sich speziell den „voll erwerbsgeminderten“ Personen öffnen, eine harmlos klingende junge Wortschöpfung des Gesetzgebers aus diesem Jahrhundert, verabschiedete die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates 1980 die Werkstättenverordnung. Mit dieser Rechtsgrundlage wurde die Basis für ein völlig neues Teilhabemodell gelegt, das erwerbsbehinderten Erwachsenen eine andere als die erwerbswirtschaftliche Arbeitswelt ermöglichte.
Meilenstein SGB IX
Der deutsche Sozialstaat, im Grundgesetz verankert, ist kein fertiges und kein statisches Gebilde. Er ist in seiner sozialen Ausgestaltung das Ergebnis eines Kräftemessens der verschiedenen sozialen Gruppierungen. Je notwendiger in wirtschaftlichen Krisenzeiten seine ausgleichende und umverteilende Funktion, um so leidenschaftlicher organisiert sich auch der Widerstand gegen ihn. Diese Erfahrungen haben die Werkstattbeschäftigten und ihre Einrichtungen besonders in den vergangenen zwei Jahrzehnten durchleben müssen. Mit vereinten Kräften konnten seit den 90er Jahre nur noch zwei wesentliche Reformen durchgesetzt werden. Diese beiden Erfolge aber ragen in der bundesdeutschen Sozial- und Rechtsgeschichte ganz besonders heraus: 1994 die Grundgesetzerweiterung im Artikel 3 um das Gebot, niemanden seiner Behinderung wegen zu benachteiligen und im Jahr 2001 die Schaffung des Neunten Buches im Sozialgesetzbuch zur „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ (SGB IX).[5]

Mit dem SGB IX verbanden die behinderten Menschen, ihre Selbsthilfe- und Interessenorganisationen die Hoffnung, dass damit die Verringerung der Sozialhilfeleistungen auf das Niveau von 1995 wieder aufgehoben würde. Denn gerade für die Werkstattbeschäftigten, die in besonderer Weise auf Leistungen zum Beistand und Nachteilsausgleich, zur Gleichberechtigung, Teilnahme, Teilhabe und Einbeziehung angewiesen sind, bedeuten Reformstau und Reformstop eine besonders schwerwiegende Benachteiligung. Als durchaus heterogene soziale Gruppe hat sie das eine Merkmal gemeinsam - das lebenslange Angewiesensein auf Hilfeleistungen.
Werkstätten sind durchaus ein „Sondersystem“, wenn es um Art, Inhalt und Umfang von Arbeit geht. Werkstattarbeit ist etwas völlig anderes als Erwerbsarbeit. Die eine will Leistungsfähigkeit, Leistungsfreude und Persönlichkeit entwickeln; die andere muss sich überflüssig machen und bis dahin ein Maximum an Erfolg aus ihr herauswirtschaften.[6]
 In der deutschen Sprache hat das Wort „sonder“ aber eine doppelte, eine zwiespältige Bedeutung und je nach dem einen negativen oder einen positiven Nutzen. Die Werkstätten und die in ihnen Beschäftigten können sich durchaus damit einverstanden erklären, dass Werkstätten sozialpolitisch etwas Besonderes, Hervorgehobenes und damit Wichtiges und Unverzichtbares sind, privatwirtschaftlichen Zielen entgegengesetzt. Es zählen nicht Aktienkurs und private Rendite, sondern Beistand, Teilhabe und Einbeziehung. Widerstand ist deshalb nötig, wenn beim Begriff „Sondersystem“ eine Diffamierung als „Absonderungssystem“ oder als „Aussonderungseinrichtung“ durchklingt. Werkstätten sondern nicht ab oder aus; sie gliedern ein, nehmen auf, lassen teilhaben und beziehen ein.
In der deutschen Sprache hat das Wort „sonder“ aber eine doppelte, eine zwiespältige Bedeutung und je nach dem einen negativen oder einen positiven Nutzen. Die Werkstätten und die in ihnen Beschäftigten können sich durchaus damit einverstanden erklären, dass Werkstätten sozialpolitisch etwas Besonderes, Hervorgehobenes und damit Wichtiges und Unverzichtbares sind, privatwirtschaftlichen Zielen entgegengesetzt. Es zählen nicht Aktienkurs und private Rendite, sondern Beistand, Teilhabe und Einbeziehung. Widerstand ist deshalb nötig, wenn beim Begriff „Sondersystem“ eine Diffamierung als „Absonderungssystem“ oder als „Aussonderungseinrichtung“ durchklingt. Werkstätten sondern nicht ab oder aus; sie gliedern ein, nehmen auf, lassen teilhaben und beziehen ein.2020?
Für eine einigermaßen zutreffende Prognose der weiteren Entwicklung bis ins Jahr 2020 fehlt es an Antworten auf vier zentrale Fragen:
- Wird die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland die begonnene Demontage des Sozialstaates als unabänderliches Geschick widerstandslos hinnehmen oder kann sie Alternativen dazu entwickeln?
- Ist die Solidarität innerhalb der deutschen Bevölkerung groß genug, um diejenigen Angehörigen zu schützen und ihre Entwicklung zur Selbstständigkeit zu garantieren, die sich aus eigener Kraft nicht helfen können?
- Werden sich die beiden großen Kirchen, die Spitzen- und Fachverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die Interessen- und Selbsthilfeorganisationen der Betroffenen zu einer gemeinsamen Initiative zusammenfinden, um den Abbau des Sozialstaates zu verhindern und den Umbau seiner Systeme sozialverträglich zu gestalten?[7]

- Gelingt es, in einem wesentlich größeren vereinten Europa die sozialen Kräfte so zusammenzuführen, dass sie der Privatwirtschaft allgemeine ethische Grundsätze zur Pflicht machen kann?
Menschen, die Alternativen für die existenzbedrohenden Krisen und ihre riskanten politischen Managementmethoden suchen, benötigen keine Neuauflage der Orwell’schen Schreckensperspektive „1984“. Wer wie die Werkstattbeschäftigten Lebensbedingungen braucht, die die Selbständigkeit und Individualität fördern, ihre soziale Akzeptanz, Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit garantieren, ist auf couragierte Mitstreiter angewiesen. Es geht in den nächsten Jahren um mehr als soziale Reformen. Es geht um Sein oder Nichtsein des Sozialstaates, um die aktive Beteiligung an seinem wirkungsvollen Umbau und um den engagierten Widerstand gegen seinen Abbruch.
Zur traditionellen Ideologie der „Leistungsgesellschaft“ gehört die Auffassung, daß jeder einzelne selbst seines Glückes Schmied wäre. Der eigene Wille wäre ausschlaggebend für das eigene Können. Der althergebrachte Begriff „Bürgerstaat“ soll den Terminus „Sozialstaat“ ablösen. Das überholte „Selfmade-Man-Modell“ wird wieder modern. So werden gesellschaftliche Konflikte individualisiert: Für Massenerscheinungen wie Arbeitslosigkeit, Armut oder Behinderung und deren Abwendung oder Milderung wird der einzelne allein verantwortlich gemacht. Gegen ihre schlimmsten Folgen wie soziale Isolierung, psychische und psychosomatische Erkrankungen muß sich der einzelne selbst engagieren. Der Staat hat begonnen, das gesetzliche Sozialversicherungssystem von dem bisherigen Gesellschafts- und Generationenvertrag der paritätischen Finanzierung durch die Erwerbswirtschaft und die Beschäftigten zu lösen. Für Bevölkerungsgruppen, denen sich ihrer Behinderung wegen die Privatwirtschaft erst gar nicht öffnet, ist diese Entwicklung eine Bedrohung.
Gleichzeitig ist in den vergangenen dreißig Jahren das Selbstbewußtsein auch der stark geistig und psychisch behinderten Erwachsenen nicht zuletzt durch die Werkstätten deutlich gewachsen. Ihre Forderungen nach Einbeziehung und Selbstverantwortung gerät mehr und mehr in Konflikt mit der benachteiligenden Umverteilung zu Lasten der sozial Schwächeren und der Ideologie des neuen Bürgerstaates, die diese Entwicklung begleitet. Das offenbart sich sowohl an immer noch geltenden diskriminierenden Rechtsnormen aus dem Jahr 1900 und den in dieser Legislaturperiode eigens geschaffenen: Das Bürgerliche Gesetzbuch mit seinen Bestimmungen über die Geschäftsunfähigkeit behinderter Erwachsener gehört ebenso dazu wie die „Hartz“- oder „Rürup“-Vorschläge in den Gesetzen zum Umbau des Arbeitsmarktes oder im SGBXII.
Wenn es im Jahr 2020 noch Einrichtungen wie die Werkstätten gibt, die den voll erwerbsgeminderten Bevölkerungsgruppen eine Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben verschaffen, dann ist das ein Erfolg des heutigen Widerstandes gegen Sozialabbau und eine politische Bevorzugung der wirtschaftlich Stärkeren. Die Kraftprobe zwischen den zwei sich prinzipiell widersprechenden Haupttendenzen ist noch nicht entschieden und fordert uns immer wieder neu heraus: Entweder gelingt die Fortsetzung des gesellschaftlichen Prozesses der Teilhabe schwerbehinderter Menschen; entweder können wir den Grundsätzen der differenzierten und individualisierten, gleichberechtigten und gleichwürdigen Teilhabe und Einbeziehung durch Beistand, Nachteilsausgleich und Förderung Geltung verschaffen. Oder es setzt sich ein neuartiger erwerbswirtschaftlich geprägter Liberalismus durch, der unter der Fahne der Eigenverantwortung und Selbstbestimmung eine krassere soziale Klassengesellschaft formt. Der heute wieder propagierte „Bürgerstaat“ würde die vom Bundeskanzler als „Faule“ bezeichneten Menschen ausschließen. Das Prädikat „faul“ ist dehnbar und läßt sich je nach wirtschaftlicher und politischer Situation auf weite Bevölkerungsteile anwenden. Für Menschen mit schweren Behinderungen hat die deutsche Geschichte seit dem 16. Jahrhundert bis heute verschiedene Szenarien parat: vom Klapperfeld zum Bettlerausweis, vom Tollhaus zur Anstalt, vom Arbeitshaus zur Vernichtungsstätte, von der Bastelstube zur „beschützenden Werkstatt“; seit 1974 von der „Werkstatt für Behinderte“ zur - offiziell seit 2001 so genannten - „Werkstatt für behinderte Menschen“.
Der nächste notwendige Entwicklungsschritt sind nicht die von der Bundesregierung besonders protegierten Integrationsbetriebe erwerbswirtschaftlicher oder gemeinnütziger Art und auch nicht die so genannten virtuellen Werkstätten. Sie sind nicht die Alternative für voll erwerbsgeminderte Erwachsene. Sie sind die eher hilflose öffentliche Reaktion auf die fehlende Bereitschaft der Privatwirtschaft, leistungsschwächere, weniger produktive behinderte Arbeitnehmer in das Erwerbsleben zu integrieren.
Der wirkliche Fortschritt für voll erwerbsgeminderte Menschen ist die Weiterentwicklung der „Werkstatt für Menschen mit Behinderungen“ zur „Werkstatt zur Arbeits- und Berufsförderung“. Die Bundesregierung war dazu im Reformprozeß des SGBIX nicht bereit. Aber auch etlichen Werkstattträgern ist dieses Ziel noch zu weitgesteckt. Denn die Firmierung ist Programm: qualifizierte und differenzierte berufliche Bildung, arbeitspädagogische Assistenz, therapeutisch notwendiger Beistand, persönlichkeitsfördernde Arbeitsinhalte, Arbeitsformen und Arbeitsmethoden, die Verwirklichung des sozialstaatlichen Teilhabeprinzips auch in gleichstellender finanzieller Hinsicht.
Eine solche Werkstatt zur Arbeits- und Berufsförderung verlangt eine tiefgreifende Verständigung darüber, daß das Attribut „behindert“ historisch überholt ist. Es hat durch seinen inflationären Gebrauch seit langem seine definitorische Kraft verloren Die „Aktion Mensch“ ist mit ihrer Namensgebung ein hervorragendes Beispiel dafür, wie aus „Sorgenkindern gleichberechtigte Bürger werden. Die früher für behinderte Menschen typischen gesellschaftlichen Folgen sind zudem längst zu Massenerscheinungen geworden und treffen ebenso auf zahlreiche andere Bevölkerungsgruppen zu, nicht zuletzt auf schul- oder lernschwache, auf sozial abgedrängte, und suchtkranke mehr und mehr auf alte und hochbetagte Menschen. Die Werkstatt zur Arbeits- und Berufsförderung muß deshalb offen für alle Personengruppen sein, die solche Leistungen beanspruchen wollen. Sie muß die heutige Bezeichnung „für behinderte Menschen“ nicht nur semantisch überwinden, sondern auch sozial. Ihren Auftrag hat sie als Teil eines demokratisch und sozial verpflichteten Arbeitsmarktes zu erfüllen. Ihre Kosten sind gesellschaftlich notwendige Kosten. Ihre Finanzierung ist eine staatliche Verpflichtung, an der sich die private Erwerbswirtschaft vorbildlich beteiligen muß. Diese Werkstätten stärken gemeinsam mit den arbeitstherapeutisch ausgerichteten Förderstätten und den Integrationsbetrieben den sozialwirtschaftlichen und gemeinnützigen Sektor. Gemeinsam erfüllen sie im geschützten und aktivierenden Arbeitsleben den gesellschaftlichen Auftrag, gleichberechtigte Teilhabe und Einbeziehung auch den Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen, die den privatwirtschaftlichen Ansprüche an Arbeitskraftverwertung und Produktivität nicht standhalten können.
[1]
 Die 1974 vom Deutschen Bundestag eingeführte und bis 2001 amtlich verbindliche Firmierung „Werkstatt für Behinderte“ ist seit den 60er Jahren bekannt: Schon im Bundessozialhilfegesetz von 1961 und der Eingliederungshilfe-Verordnung von 1964 wurde diese Bezeichnung benutzt. Horst H. Cramer weist jedoch darauf hin: „Mit diesem Begriff verband sich aber noch kein gesicherter, definitorisch klar umrissener Inhalt. Dementsprechend bot sich auch in der Wirklichkeit ein sehr unterschiedliches Erscheinungsbild “Horst H. Cramer, Schwerbehindertengesetz, 5. Auflage, Vahlens Kommentare, München 1998, S.466, RdNr. 3. Mit Inkrafttreten des SGB IX im Jahr 2001 heißen die Werkstätten offiziell „Werkstätten für behinderte Menschen“.
Die 1974 vom Deutschen Bundestag eingeführte und bis 2001 amtlich verbindliche Firmierung „Werkstatt für Behinderte“ ist seit den 60er Jahren bekannt: Schon im Bundessozialhilfegesetz von 1961 und der Eingliederungshilfe-Verordnung von 1964 wurde diese Bezeichnung benutzt. Horst H. Cramer weist jedoch darauf hin: „Mit diesem Begriff verband sich aber noch kein gesicherter, definitorisch klar umrissener Inhalt. Dementsprechend bot sich auch in der Wirklichkeit ein sehr unterschiedliches Erscheinungsbild “Horst H. Cramer, Schwerbehindertengesetz, 5. Auflage, Vahlens Kommentare, München 1998, S.466, RdNr. 3. Mit Inkrafttreten des SGB IX im Jahr 2001 heißen die Werkstätten offiziell „Werkstätten für behinderte Menschen“.[2]
 vgl. Grundsätze zur Konzeption der Werkstatt für Behinderte, BT-Drucksache 7/3999 vom 5.12.1974. Siehe auch den BAG WfbM-Ausstellungskatalog „Vom Tollhaus zur Werkstatt für behinderte Menschen“.
vgl. Grundsätze zur Konzeption der Werkstatt für Behinderte, BT-Drucksache 7/3999 vom 5.12.1974. Siehe auch den BAG WfbM-Ausstellungskatalog „Vom Tollhaus zur Werkstatt für behinderte Menschen“. [3]
 vgl. §§104, 105 BGB
vgl. §§104, 105 BGB[4]
 E.Funke, G.G.Wendt (Hrg.), Rehabilitation ’77 – Wege zur Prävention und Integration, Die Medizinische Verlagsanstalt, Marburg/Lahn 1977, S.7
E.Funke, G.G.Wendt (Hrg.), Rehabilitation ’77 – Wege zur Prävention und Integration, Die Medizinische Verlagsanstalt, Marburg/Lahn 1977, S.7[5]
 vgl. BGBl I S.1046
vgl. BGBl I S.1046[6]
 vgl. auch Günter Mosen, Ulrich Scheibner, Arbeit, Erwerbsarbeit, Werkstattarbeit, Selbstverlag der BAG WfbM
vgl. auch Günter Mosen, Ulrich Scheibner, Arbeit, Erwerbsarbeit, Werkstattarbeit, Selbstverlag der BAG WfbM [7]
 vgl. dazu: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Hannover und Bonn 1997
vgl. dazu: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Hannover und Bonn 1997